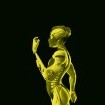«Zu uns Menschen gehört, dass wir verwundbar sind», sagt der reformierte Theologe Otto Schäfer, Mitglied der französischsprachigen Ethikervereinigung «Association de Théologiens pour l’Étude de la Morale». Visionen immer menschlicherer Maschinen und zunehmend maschinenhafter Menschen seien an individueller Leistungsfähigkeit orientiert. «Der Transhumanismus will unser Wesen aus Fleisch und Blut, Saft und Schleim mit sauberer Technik überwinden», sagt der Theologe.
Dabei werde in diesen Szenarien oft ausgeblendet, dass Leibliches und Seelisches eng zusammengehören. «Und Menschenwürde betrifft nicht nur selbstbestimmtes, leistungsfähiges Leben, sondern schliesst die Tatsache mit ein, dass wir verwundbar und aufeinander angewiesen sind», sagt Schäfer. Als Biologe findet er es faszinierend, dass diese kooperative Sicht auf das Leben in verschiedenen Forschungsbereichen aktuell ist – etwa die Symbiose zwischen Mikroorganismen und Körper oder die Epigenetik, die zeigt, wie unser Erbgut auf Umwelteinflüsse reagiert.
«Die Verwundbarkeit des Menschen bestimmt auch die christliche Sicht auf Dual-Use-Güter und ihren Export», betont Schäfer. «Wobei die Opfer im Mittelpunkt der Betrachtung stehen.» Interessant in diesem Zusammenhang findet Schäfer die reformierte Erwählungstheologie: Gott wendet sich nicht den starken Völkern zu, sondern sucht sich das kleine, schwache Volk Israel aus.
Ein weiteres Beispiel der Erwählungstheologie sieht Schäfer in der «unvergleichlichen» Rolle, die Gott «der scheinbar unbedeutenden» Maria von Nazareth übergibt, und zitiert den Lobgesang der Maria: «Mächtige hat er vom Thron gestürzt und Niedrige erhöht» (Lk 1,52). Die theologische Ethik könne nicht anders, als sich für die Verwundbaren einzusetzen und dem gesellschaftlichen Trend der Macht des Stärkeren entgegenzuwirken.
Absolut ist nur Gott
Seit 2016 ist der Theologe Mitglied der Eidgenössischen Kommission für die Biotechnologie im Aussenhumanbereich (EKAH). Sie berät die Bundesverwaltung im Bereich der ausserhumanen Bio- und Gentechnologie aus ethischer Sicht. Die EKAH nahm etwa Stellung zur Debatte, ob es richtig war, dass in den USA Forschungsergebnisse zu einem genetisch veränderten Vogelgrippevirus veröffentlicht wurden.
Gegen eine Publikation sprach die Gefährdung der öffentlichen Sicherheit, weil der Bericht als Bastelanleitung für eine biologische Waffe genutzt werden könnte. Eine Veröffentlichung würde aber auch die weitere Forschung anregen. Die EKAH kam zum Schluss, dass im Konfliktfall der Wert der wissenschaftlichen Erkenntnis gegenüber anderen Werten wie dem Leben und Umwelt abzuwägen sei. «Die Forschung soll nicht gegängelt werden, das spricht mich als Naturwissenschaftler an», sagt Schäfer. «Aber Forschungsfreiheit ist auch nicht absolut – da finde ich mich als reformierter Theologe gut wieder: Absolut ist nur Gott, und sogar er ist wesentlich Beziehung.»