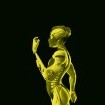Ein Begriff geistert derzeit durch die Medien: Human Enhancement. Was ist damit gemeint?
Christina Aus der Au: Das sind grob gesagt die technischen Möglichkeiten, körperliche Mängel zu beheben oder die geistige Leistungsfähigkeit zu verbessern. Eigentlich ist nur das englische Wort neu, die Technik ist alt. Wir beide haben ja auch eine Brille auf der Nase sitzen.
Wenn wir aber statt einer Brille auf der Nase zum Beispiel ins Hirn eingebaute Elektroden tragen und wie Roboter gesteuert werden, dann haben wir ein Problem.
Das ist noch sehr weit weg. Es gibt sowohl gute Gründe, für eine Begrenzung der Neurowissenschaften zu argumentieren, als auch, für die regulierte Freigabe des Human Enhancements zu plädieren.
Was spricht nun dafür?
Wissenschaftler forschen bereits länger an der neuronalen Signatur von Gedanken. Aus dem Hirnscanner kann schon abgelesen werden, welche Filme sich die Versuchsperson ansieht oder an welche Person sie denkt. Andere arbeiten mit depressiven Mäusen, denen sie mit «falschen Erinnerungen» neuen Lebensmut einpflanzen. Das lässt betroffene Menschen hoffen.
Das tönt wissenschaftsoptimistisch. Könnten Sie sich eine Situation vorstellen, in der Sie persönlich auf den Fortschritt der Neurowissenschaft hoffen?
Wenn ich plötzlich vollständig gelähmt wäre, dann wäre es doch ein grosser Fortschritt, meine Prothese oder meinen elektrischen Rollstuhl mit Gedanken steuern zu können.
Was sind aber die negativen Aspekte der Neurowissenschaften?
Was wir die Dual-Use-Problematik nennen. Auch die Militärs fördern diese Forschung, um feindliche Absichten lesen oder sogar umsteuern zu können. Doch wir dürfen nicht vergessen: Man kann nicht nur zivile Errungenschaften militärisch nutzen, sondern umgekehrt militärische Forschung auch zivil nutzbar machen, wie zum Beispiel das Internet, auf das die meisten Menschen wahrscheinlich nicht mehr verzichten möchten.
Deshalb zögern Sie, ein Verbot oder zumindest ein Forschungsmoratorium zu fordern?
Gerade die Theologen waren in der Vergangenheit rasch dabei, wissenschaftlichen Fortschritt durch Verbote zu bremsen. Wenn man der Kirche ihren Willen gelassen hätte, dann hätte Leonardo da Vinci keine Leichen untersuchen dürfen. Dann hätte man keine Impfstoffe entdeckt. Und überhaupt kann ich mir gut vorstellen, dass ich dann wahrscheinlich schon lange tot wäre.
Aber angesichts der möglichen negativen Auswirkungen neurowissenschaftlicher Forschung braucht es doch strenge Regeln?
Natürlich müssen wir darüber nachdenken, doch die Sache ist extrem ambivalent. Ich will nicht vom hohen Ross herunter letztgültige Moralkonzepte und kontextfreie Prinzipien predigen. Deshalb ist es bei einer wissenschaftsethischen Abwägung wichtig, beide Seiten anzuschauen, auch diejenigen Argumente, die für die neurowissenschaftlichen Innovation sprechen.
Und das Eindringen in das menschliche Hirn ist nicht ein Sündenfall, der nach strikten Grenzen ruft?
Ich finde es schwierig, eine solche Grenze absolut zu bestimmen, vor allem, wenn sie mit dem Anspruch daherkommt, zeitlos gültig zu sein. Ich glaube, Grenzen sind etwas, das wir immer wieder von Neuem aushandeln müssen. Das sollte auch immer vor dem Hintergrund des jeweiligen technischen Fortschrittes und des gesellschaftlichen Wandels geschehen. Es ist aber wichtig, dass die Forschung von einer gesellschaftlichen Reflexion begleitet wird, die auch die Folgen der Innovation und die Möglichkeiten des Missbrauchs berücksichtigt.
Existieren heute die Foren, um das gesellschaftlich auszuhandeln?
Wir haben nicht nur die nationale Ethikkommission. Heute sind solche Gremien in fast jedem Spital institutionalisiert. Zentral scheint mir darüber hinaus, dass wir die Fragen breit in der ganzen Gesellschaft diskutieren. Jedes Jahr bei Vorlesungen mit Medizinstudierenden der Universität Freiburg stelle ich fest: Sie stehen ungebremster Forschung sehr skeptisch gegenüber.
Das bildet das Unbehagen ab, das viele Menschen teilen: die Angst vor manipulierten Menschen.
Die Angst hat viel mit dem Mythos zu tun, der in Mary Shelleys Roman «Frankenstein» ein wirkmächtiges Bild erhielt und immer wieder neu variiert wurde. Auch im Film «2001: A Space Odyssey» von Stanley Kubrick versucht der Supercomputer HAL, das Kommando zu übernehmen. Die Vorstellung, dass die Geister, die der Mensch rief, eine Eigendynamik entwickeln, hat eine ungeheure Sogwirkung.
Schon die jüdische Mystik entwarf mit dem Golem ein Kunstgeschöpf.
Der Golem ist der Urahn der Zombies. Und wie sie hat er keine Seele. Die Seele kann nämlich nur Gott einem Geschöpf verleihen. Das Spannende an den Neurowissenschaften ist nun, dass sie von der Vorstellung ausgeht: Auch was wir Seele nennen, ist Körper. Damit sei alles dem Menschen zur Verfügung gestellt.
Und wo bleibt Gott?
Er spielt nun für einen säkularen Neurowissenschaftler keine Rolle. Aus seiner Perspektive hat er völlig recht, wenn er sagt: Die Hypothese von Gott haben wir für unsere Forschung nicht nötig.
Und das nehmen Sie als Theologin einfach so zur Kenntnis?
Damit wir uns nicht falsch verstehen, ich bin ein religiöser Mensch. Gott ist für mich aus keinem Bereich des Lebens wegzudenken. Im eng abgesteckten Rahmen ihrer Methodologie können Wissenschaften auf den Gottesbegriff verzichten. Aber das sollte die Forscher nicht dazu verleiten, ihr wissenschaftliches Weltbild zu überhöhen.
Wie meinen Sie das?
Es gibt Forscher wie den Biogenetiker Richard Dawkins, die meinen, aufgrund ihrer wissenschaftlichen Erkenntnisse könnten sie Gott wegerklären. Das ist eine Konsequenz, die sie aufgrund ihrer eigenen Voraussetzungen nicht ziehen können.
Und was könnte in dieser Diskussion die Rolle der Kirche sein?
Die Kirche sollte die Leute dazu anregen, über die zentralen Fragen nachzudenken und miteinander ins Gespräch zu kommen: Was heisst gutes Leben? Was hoffen wir für unsere Kinder? Was ist unser Menschenbild?