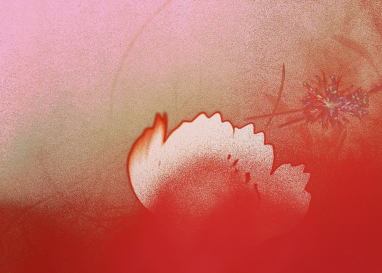Wer C. G. Jung näherkommen will, nimmt am besten einen Augenschein in seinem Küsnachter Wohnhaus. Längst ist es ein Pilgerort für Jungianerinnen und Jungianer, die Führungen sind regelmässig ausgebucht. Das Besondere an diesem Ort: Salon, Speisezimmer, Wintergarten, Arbeitszimmer, Bibliothek, Therapiezimmer – die wichtigsten Räume sind heute noch genauso eingerichtet wie am 9. Juni 1961, als C. G. Jung in Küsnacht zu Grabe getragen wurde.
Gott ist immer da
Der Spruch auf seinem Grabstein hatte ihn das ganze Leben lang begleitet: «Vocatus atque non vocatus deus aderit», gerufen oder nicht gerufen, Gott wird da sein. Oder: Gott ist immer da, ob wir ihn rufen oder nicht. Diesen Satz liess er auch in den Sandsteinfries über der Schwelle zu seiner Haustür in Küsnacht einmeisseln. In einem Brief legte er dar, dass sein Lebensmotto auch seine Patientinnen und Patienten an die Gottesfurcht erinnern solle. Die Furcht vor Gott sei der Ursprung aller Weisheit, wie es im biblischen Buch der Sprichwörter heisst.
Gegenüber dem Schweizer Radio erklärte der Psychiater 1960 seine Faszination für den Spruch so: «Ich habe eben die Erfahrung gemacht, dass diese sogenannten Erfahrungen überall vorhanden sind, ob beabsichtigt oder nicht.» Davon zeugten auch die Ausrufe des Erstaunens von Menschen, die vielleicht nicht einmal an Gott glaubten und dennoch bei bestimmten Phänomenen ausriefen: «Oh Gott», «mein Gott». Jung war überzeugt: Wenn das Ich aufgebe und nicht mehr die oberste Instanz des psychischen Geschehens sei und etwas anderes für einen eintrete, sei Gott am Werk.
Abenteuer der Selbstfindung
Im Wintergarten mit Blick auf den Garten und das nahe Seeufer steht auf hohem Sockel eine Büste von Homer, dem griechischen Dichter der Odyssee. Jung liess sich gern mit ihr ablichten.
Da ist sie wieder, die metaphorische Seelenfahrt übers Wasser, wo allerlei Prüfungen auf einen warten und letztlich das Abenteuer der Selbstfindung winkt. Auch der Pelikan, nach dem er sein geliebtes Segelschiff benannt hat, findet sich an verschiedenen Plätzen im Haus, als Keramikfigur zuoberst auf dem opulenten blauen Kachelofen im Salon oder als Gemälde über der Tür, die zum Esszimmer führt: Der Wasservogel ist ein altes Symbol für Christus und ein alchemistisches Zeichen für Transformation.
Überraschendes Bekenntnis
Die BBC hatte Jung in einem Interview mit der Frage überrascht, ob er an Gott glaube. «Ich habe es nicht nötig, an Gott zu glauben, ich weiss es», lautete die Antwort. Er sei nachher über seinen Ausspruch erstaunt gewesen. Natürlich will er nicht objektiv Gottes Existenz propagieren, aber er weiss, dass es ihn gibt, weil er ihn subjektiv erfahren hat, innerpsychisch, seelisch erlebt.
In seiner autorisierten Biografie beschreibt Jung seine Visionen während und nach einem Herzinfarkt 1944. Danach war nichts mehr, wie es zuvor gewesen war. «Die Erkenntnis oder die Anschauung vom Ende aller Dinge gaben mir den Mut zu neuen Formulierungen.» Was Jung da beschreibt, ist eine eigentliche Erleuchtung in mehreren Stufen. Eine mystische Erfahrung voller Glückszustände und Schönheit.