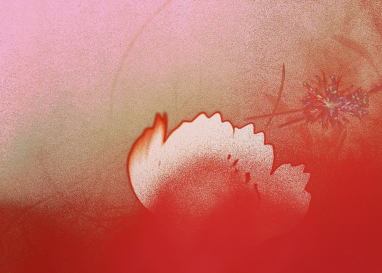Als Vater der Psychoanalyse gilt der Wiener Seelendoktor Sigmund Freud (1856–1939). Der um knapp 20 Jahre jüngere, in Kesswil TG als Pfarrerssohn geborene Carl Gustav Jung studierte in Basel Medizin, spe-zialisierte sich auf Psychiatrie und empfing von Sigmund Freud vielfältige Impulse. Beide setzten bei der Behandlung von seelischen Erkrankungen darauf, die bewussten und unbewussten Anteile des Menschen zusammenzuführen und miteinander auszusöhnen. Mittel der Wahl war die Traumdeutung.
Geheimnisvolle Muster
Freud sah die Ursache seelischen Leidens im unterdrückten Sexualtrieb. Jung dagegen unterteilte die Tiefenschichten der menschlichen Psyche in persönliche und kollektive Anteile. Letztere nannte er das kollektive Unbewusste. Dieses äussert sich in den Archetypen, in ererbten psychischen Grundmustern also, die auf den Menschen einwirken.
Divergierende Auffassungen in der Lehre beendeten die eher kurze, aber vertraute Zusammenarbeit zwischen Freud und Jung. Letztlich passten die beiden schlecht zusammen: Freud, der atheistische Materialist und Rationalist, und Jung, der Mystiker, dessen Psychologie des Irrationalen auch einiges an Zivilisationskritik enthält.
Religion als fester Bestandteil des Menschseins
In der universitären Psychologie kommen Freud und Jung heute kaum mehr vor – nicht zuletzt, weil sich viele ihrer Annahmen nicht verifizieren lassen. In der therapeutischen Praxis spielen aber beide nach wie vor eine Rolle, Jung dazu in der Religionspsychologie.
Jung habe Religion als festen Bestandteil des Menschseins definiert, schreibt der Berner Seelsorgeprofessor Christoph Morgenthaler als einer der Autoren im Buch «Klassiker der Religionswissenschaft».
Religiosität habe für Jung aber nicht in erster Linie die Zugehörigkeit zu einer bestimmten Glaubensgemeinschaft bedeutet, sondern das Ergriffensein durch das Numinose, das geheimnisvolle Göttliche. Ausführlich setzte er sich zudem mit der christlichen Tradition auseinander.
Schuld auf sich geladen
Ein dunkles Kapitel sind C. G. Jungs Verflechtungen mit dem Nationalsozialismus und sein Verhältnis zum Judentum. In seinem Aufsatz «Wotan» aus dem Jahr 1936 beschreibt er den Wandergott der Germanen als archetypische Verkörperung der unzähmbaren germanischen Seele. Diese rauschhafte Gestalt äussere sich auch im Handeln der Nationalsozialisten in Deutschland.
Mit seinen undistanzierten Ausführungen habe Jung die Nazi-Bewegung «zum Ausbruch ehrfurchtgebietender Brausegötter» verklärt: So kritisiert der Politologe Richard Gebhardt in seiner Schrift «Jung und der deutsche Faschismus». Darüber hinaus habe er in der Zeit des Dritten Reichs als Vorsitzender der psychiatrischen Berufsorganisation gegen die Theorien der Psychoanalyse des Juden Sigmund Freud agitiert.