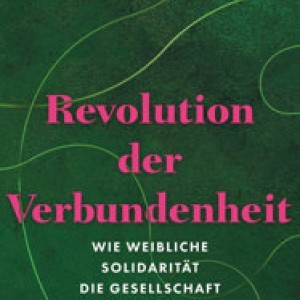Die Schweizer Geschlechterforscherin und Soziologin Franziska Schutzbach las im Basler Zwinglihaus aus ihrem neuen Buch «Revolution der Verbundenheit». In ihrem Vortrag betonte sie die Bedeutung von Solidarität unter Frauen und zeigte, wie selbst kleinste Schritte diese Revolution voranbringen.
In ihrem Buch vertritt Schutzbach die These, dass weibliche Solidarität patriarchale Strukturen im Alltag und in der Politik durchbrechen kann. Sie unterstreicht, dass Frauen durch gegenseitige Unterstützung und politische Schwesternschaft gesellschaftliche Veränderungen anstossen.
Mit Beispielen aus Vergangenheit und Gegenwart verdeutlicht sie, wie Frauen trotz Unterschiede durch ihre Beziehungen Revolutionen ermöglichten. Der «Kirchenbote» sprach mit Franziska Schutzbach im Vorfeld des Frauenstreiktags am 14. Juni.
Mit «Revolution der Verbundenheit» haben Sie ein mitunter hoffnungsvolles Buch geschaffen. Hätten Sie es als junge Frau selbst gern gelesen?
Franziska Schutzbach: Tatsächlich brauche ich dieses Buch erst jetzt als Frau im mittleren Alter. Als junge Frau war ich sehr kämpferisch und voller Hoffnung. Gerade erlebe ich eine Zeit der grossen Ernüchterung. Das liegt einerseits an den aktuellen gesellschaftlichen und politischen Umständen, hat aber andererseits auch mit dem Alter zu tun.
Inwiefern?
Wenn man älter wird, legt man eine gewisse Naivität ab. Der eigene Blick auf die Welt wird komplexer. Das beobachte ich auch bei meinen Weggefährtinnen: Was heisst es, mit über vierzig noch eine aktivistische Identität zu haben? Ein Buch, das ganz grundlegend die Frage von Solidarität und Beziehung unter Frauen stellt, ist sowohl für mein Alter als auch für die aktuelle Zeit sehr relevant.