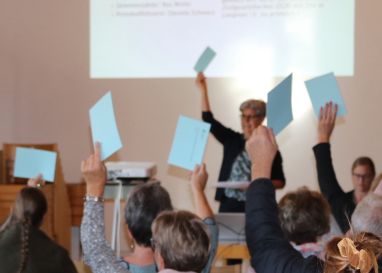Unfair, überflüssig, teuer – so lauteten die Argumente zur Abschaffung der Gewissensprüfung 2008. Bis dahin mussten Militärpflichtige begründen, warum sie Zivildienst statt Armeedienst leisten wollten.
Als unfair galt die Gewissensprüfung, weil besser Gebildete sie häufiger bestanden als junge Männer mit kleinerem Schulrucksack. Als überflüssig, weil sich das Gewissen nicht prüfen lasse: 90 Prozent der Gesuche wurden bewilligt. Das Verfahren kostete den Staat jährlich 3,6 Millionen Franken.
Nun aber, mit der veränderten sicherheitspolitischen Lage, steht das Verfahren wieder zur Diskussion. Der Nationalrat beauftragte den Bundesrat mit einem Postulat, die Wiedereinführung des Instruments zu prüfen. Die Staaten rüsten auf, und auch in der Schweiz wird die Forderung nach einer stärkeren Armee mit mehr Personal lauter. Die Hoffnung ist, dass mit einer Gewissensprüfung die Armee wieder auf mehr Dienstpflichtige zählen kann. In den letzten Jahren verzeichnete der Zivildienst steigende Gesuchszahlen.
Nachfrage stark gestiegen
Damit stellt sich allerdings erneut die Frage, wie sich die individuelle Werthaltung testen lässt. «Das Gewissen entzieht sich grundsätzlich einer Prüfung von aussen», sagt David Zaugg von der Evangelisch-reformierten Kirche Schweiz (EKS), wo er für politische Kommunikation verantwortlich ist.